„Selbst der Samurai nimmt seine Rüstung ab, um die Chrysanthemen zu bewundern.“ (Vervoordt)
Keine Angst, hier ist nicht alles Zen. Aber ganz ohne geht es eben auch nicht. Ich empfehle daher nur jenen die Lektüre dieses Artikels, die wirklich Lust haben, etwas tiefer in die Frage nach der japanischen Ästhetik einzusteigen, die also wirklich Lust und Muße haben, das gewisse Etwas Japans besser zu verstehen.
Ich beginne ja immer gerne ganz am Anfang. Ein guter Freund kam mit einer einfachen aber sehr eindringlich formulierten Frage auf mich zu: „Kannst du mir mal sagen, warum in Japan eigentlich immer alles so schön sein muss? So vieles in Japan hat einfach was. Aber was?“ Wir hatten lange gesprochen und waren uns auch nicht immer einig. Aber es waren Diskussionen wie diese, mit Freunden, Bekannten und Verwandten, die mich dazu motivierten, mit Kunst aus Japan in dieser Form überhaupt erst zu beginnen. Japan sei irgendwie anders. Japan sei einfach „schön“. Tatsächlich wollten viele mehr darüber erfahren.
Aber Vorsicht. Japan immer nur als gänzlich schön zu beschreiben, wäre auch nicht richtig. Der ein oder andere wusste auch vom Gegenteil zu berichten, vom Hässlichen, von den pragmatisch abwaschbaren Fassaden moderner Gebäude, von überirdisch verlaufenden Stromleitungen, schmucklosen Promenaden, vom krassen Gegensatz zwischen geistig beflügelnden Zen-Gärten und begradigten Flüssen im Betonkorsett. Ja, manchmal ist die Schönheit Japans nicht im Weitwinkel zu erkennen, sie zeigt sich im Detail, in der unwiderstehlichen Zusammensetzung der Dinge, im Moment.
Bei genauerer Betrachtung scheinen sich Liebhaber und Laien aber doch auf eines zu verständigen: Japan hat ein spezielles Bewusstsein für das Schöne, sagen wir einfach, ein „ästhetisches Gespür“. Dabei geht es aber nicht um Schönes im oberflächlichen Sinne. Es geht um eine Schönheit, die in der scheinbar unergründlichen Tiefe der Dinge liegt. Es sei schwer zu erklären. Doch das ganze Leben scheint in Japan einem zutiefst ästhetischen Anspruch zu folgen. Die Frage ist nur – warum?
Einige, mit denen ich über das „schöne Japan“ sprach, konnten auch klar formulieren, was ihnen dabei vorschwebte: der Zen-Garten, die schlichte alte Teeschale, die Tuschezeichnung, der Bogenschütze im morgendlichen Dôjô – aber auch leuchtende Farben, den prächtigen Kimono einer Geisha, goldene Wandschirme aber auch edle moderne Verpackungen oder einfach eine Platte mit kunstvoll angerichtetem Sushi.
Was verbindet all diese Dinge und Ausdrucksformen? Haben sie so etwas wie einen gemeinsamen ästhetischen Kern? Oder handelt es sich bei all dem etwa um Kunst?
Kunst aus Japan. Was zählt in Japan eigentlich alles zur Kunst?
Die Frage nach der Kunst in Zusammenhang mit dem Schönen ist eine sehr westliche Frage. Doch sie ist insofern interessant, als nach westlichem Verständnis die Auseinandersetzung mit der Ästhetik nicht immer, aber doch häufig, insbesondere ab der Neuzeit, an die Kunst geknüpft war. Nach westlich-philosophischem Verständnis war die Auseinandersetzung mit der Ästhetik im Wesentlichen eine Auseinandersetzung mit den Theorien der Kunst. Hilft uns diese Herangehensweise auch in Japan weiter, um „die Ästhetik“ oder das „warum so viel Schönes“ besser zu verstehen? Mal sehen. Vielleicht lohnt zunächst die Frage, was in Japan eigentlich alles unter den Begriff „Kunst“ fällt.
Ohne diese Kategorisierung nun allzu philosophisch anzupacken, würde ich in Japan unter dem Oberbegriff Kunst drei Ausdruckformen anführen: Bildende Kunst, Handwerkskunst und Künste.
Bildende Kunst
Es gibt sicherlich Ausdrucksformen, die in Japan im klassischen Sinne als Kunst, „fine art“ oder bildende Kunst zu bezeichnen sind. Hierzu zählen die Malerei (etwa auf Stellwänden, Schiebetüren oder Wänden), einige Teile der Keramik oder die Skulptur, darunter auch Masken und Netsuke (kleine geschnitzte Schmuckstücke). Die „Ästhetik des Objekts“ und das „Wohlgefallen“ an sich, markieren das zentrale Wesen dieser Form von Kunst, auch in Japan. Yanagi Sôetsu würde die bildende Kunst auch als „individuellen Ausdruck“ des Künstlers bezeichnen, der sich in seinem Werk eventuell sogar selbst verwirklichst sehen will. Dies sei auch die wesentliche Abgrenzung zum Handwerk.

Handwerkskunst
Neben der bildenden Kunst ist die Handwerkskunst aufzuführen. Besonders hervorzuheben ist dabei, dass in Japan die Grenze zwischen der bildenden Kunst und dem Kunsthandwerk immer fließend war. Im vormodernen Japan wurde gar nicht zwischen Kunst und Kunsthandwerk unterschieden. Selbst heute würde man noch immer attestieren, dass die Grenzen zwischen Kunst, Handwerk und Design fließend sind.
Dennoch, kunsthandwerkliche Gegenstände sind solche, die nicht primär als Kunstwerk, als für den tatsächlichen Gebrauch geschaffen wurden: Lackgegenstände, Textilien, etwa für aufwendige Kimonos, Metall und Holzwaren, die Schwertschmiedekunst, der Farbholzschnitt. Auch Fahr-Becker schreibt in ihrem Standardwerk zur Ostasiatischer Kunst, dass es sich in Japan um Handwerk auf höchstem Niveau handelt. Diese Gegenstände wurden daher nicht umsonst wie „Kunstwerke“ verehrt und sie werden es noch heute. Die Keramik hatte in vielerlei Hinsicht einen besonderen Stellenwert. Sie hatte in ausgewählten Fällen den Stellenwert „echter Kunst“ im Sinne von fine-art inne, etwa jene aus den sogenannten alten Öfen oder Werkstädten Japans, die bisweilen auf eine 1000-jährige Tradition zurückblicken (Tokoname, Echizen, Seto etc.). Besonders reizvoll ist in diesem Zusammenhang, dass in Japan die Industrialisierung erst spät einsetzte, also noch lange Zeit vieles von Hand und nicht maschinell gefertigt wurde – aus heutiger Sicht ein unglaublicher Schatz.
Künste
Neben bildender Kunst und Handwerkskunst kommen nun noch die Künste ins Spiel. Damit meine ich jene Künste, die auch als „Weg-Künste“ bezeichnet werden, etwa die Teezeremonie (chadô – Weg des Tees), die Kalligraphie (shodô – Weg der Schreibkunst), die Tuschemalerei (sumi-e – Weg des Pinsels). Es geht auch um die Kunst des Blumensteckens (kadô), zahlreiche Kampfkünste, wie kendô (der Weg des Schwerts) oder kyudô (der Weg des Bogens). Auch der japanische Gartenbau zählt dazu. Dabei folgt der Mensch einer vorgegebenen Weise des Praktizierens. Er folgt einem Ritual oder eben Weg (dô). Dieser Weg stellt einen sehr eigenen Zugang zur Kunst dar, der auf den Seiten der japanischen Botschaft wie folgt beschrieben wird: „So wie beim Zen-Buddhismus die Erleuchtung nur durch intuitive Erfahrung erlangt werden kann, so ist es auch beim Streben nach Meisterschaft in der jeweiligen Kunst notwendig, der eigenen schöpferischen Freiheit beim Praktizieren keinen Raum zu geben. Denn die zu erstrebende wahre und echte Freiheit liegt in der Verneinung des eigennützigen Ich und in der Aufgabe jeglicher Willkür beim Praktizieren. Dies erfordert eine strenge Selbstschulung der Freiheit, wenn sie – und damit letztendlich auch die Meisterschaft – erreicht werden soll.“
Das Ziel dieses Praktizierens ist aber nicht primär das gelungene Resultat (ein schönes Objekt) oder die kreative Übung, sondern die Erleuchtung des Praktizierenden, die er in der Meditation der Praxis kultiviert. Dies ist ein anderer Ansatz als bei der bildenden Kunst, die den Wohlgefallen, also das ästhetische Resultat, zuoberst stellt. Dass aber auch die Resultate der Weg-Künste, einem von höchster Konzentration geprägtem Prozess, meist von besonderer Güte sind, liegt auf der Hand. Neben dem Zen-Buddhismus war der Daoismus prägend für die Weg-Künste.
Interessant ist es nach dieser Kategorisierung nun, auf jene Bilder zurückzukommen, die eingangs als „das schönen Japan“ beschrieben wurden: der prächtig bemalte Wandschirm, der Zen-Garten, die alte Teeschale, der Bogenschütze im morgendlichen Dôjô oder der Stoff eines üppigen Kimonos. Ohne sich damit intensiv befasst zu haben, hatten meine Gesprächspartner intuitiv eine repräsentative Auswahl an japanischer Kunst aufgeführt. Auffallend ist allerdings, dass „die Kunst“ in Japan ein enorm breites Feld ist: von der bildenden Kunst über das Teekochen bis hin zur körperlichen Ertüchtigung. Tatsächlich gibt es in Japan ein sehr breites Spektrum an Praktiken, die der Kunst zugesprochen werden, Praktiken die in der Tat das Schöne hervorbringen. Der westliche Kunstbegriff wäre deutlich schmäler. Nach westlichem Ermessen würde etwa das rein Praktische, oder das lediglich Moralisch-spirituelle, nicht zwingend zur Kunst zählen. In Japan tut es das doch.
Das Abstecken der japanischen Kunst – vielleicht war dies auf der Suche nach der japanischen Ästhetik nur eine erste Fingerübung. Sie zeigt uns aber doch, dass uns die Auseinandersetzung mit den Theorien der Kunst nicht weit bringt, wenn schon das Verständnis von Kunst nicht übereinzubringen ist. Das gewisse Etwas, das unbedingte Streben nach Schönheit, nach Ästhetik, geht über den ohnehin schon breiten Radius der japanischen Kunst noch weit hinaus. Denn was ist mit all den wunderbaren Speisen, den modellierten Süßigkeiten (wagashi) und Sushiplatten, die schöner sind als ein Gedicht? Was ist mit den Verpackungen für Lebensmittel oder andere Produkte, edel und aufwendig designt wie eine Verheißung? Was ist mit dem Geschirr, das sowohl in Restaurants als auch in Privathaushalten den Farben der Jahreszeit entsprechend zum Einsatz kommt?
Der springende Punkt ist, dass in Japan die Auseinandersetzung mit dem Ästhetischen oder Schönen nie eine Auseinandersetzung mit den Theorien der Kunst war, als schlicht und einfach eine Auseinandersetzung mit den Theorien des Geschmacks. Die Theorien des Geschmacks beziehen sich auf viele Lebensbereiche – oder sagen wir es klarer, auf fast alle. Es bedarf folglich anderer Betrachtungen, um das gewisse Etwas Japans zu verstehen.
Was bedeutet nun „Ästhetik“ in Japan? Und warum gibt es dort so viele ästhetische Prinzipien und Konzepte?
Zum Begriff Ästhetik: Führt man die westliche Bedeutung des Wortes Ästhetik auf seinen eigentlichen Wortstamm zurück, so steht dieser für Wahrnehmung oder Empfindung (altgriechisch aísthêsis). Die Ästhetik wäre folglich nichts weiter, als „die Lehre von der Wahrnehmung“, ganz gleich ob es dabei um angenehme, unangenehme oder neutrale Wahrnehmung geht. Fasst man die Ästhetik sehr allgemein, wird sie auch als Theorie der sinnlichen Erkenntnis bezeichnet.
Im allgemeinen Sprachgebrauch wird Ästhetik dagegen mit Schönheit, angenehmen Reizen oder erlesenem Geschmack in Verbindung gebracht, was letztlich auch in Theorie und Philosophie so verankert ist. Mit der Ästhetik als Maß für Schönheit ging aber auch die Abgrenzung vom lediglich Erfreulichen, lediglich Moralischen oder vom Nützlichen einher, wie es bereits zu lesen war.
Historisch betrachtet ist nun bemerkenswerte, dass es den Begriff der Ästhetik in Japan einfach nicht gab.
Donald Richie fragt daher, ob die Auseinandersetzung mit dem Schönen in Japan folglich von geringerer Bedeutung war, oder der Gegenstand von einer solch hervorzuhebenden Bedeutung war, dass man ihn für selbstverständlich hielt. Ganz sicher ist in Japan letzteres der Fall. Einzelne Elemente von ästhetischer Tragweite oder bestimmte Fragen des Geschmacks waren im einstigen japanischen Leben so weit verbreitet, dass es unnötig erschien, dafür einen zentralen Begriff zu finden. Die Ästhetik wird, anders als im westlichen Denken, nicht als Philosophie betrachtet, denn als integraler Bestandteil des täglichen Lebens. Mehr dazu in dem Artikel Kunst aus Japan ist lebendig. Entsprechend ist in Japan von einem Grundvokabular zu Fragen des Geschmacks die Rede, und dieses Vokabular ist groß.
Doch bleiben wir an dieser Stelle doch noch bei den Unterschieden zwischen westlichem und japanischem ästhetischem Verständnis. Relevant ist dabei, dass der Begriff der Ästhetik im westlichen Kulturkries auch erst seit 1750 gebräuchlich ist, und zwar um eine Wissenschaft zu beschreiben: die Wissenschaft der sinnlichen Erkenntnis. Danach ist der Gegenstand der Ästhetik die Schönheit. Die Ästhetik unterscheidet sich wiederum deutlich von der Logik. Deren Gegenstand ist die Wahrheit. Schönheit und Wahrheit gehören nach westlichem Ermessen folglich nicht in eine „Wissenschaft“. Ganz anders in Japan.
Dieser Unterschied ist bemerkenswert, will man dem Grund nachspüren, weshalb die Fragen des Geschmacks in Japan seit jeher derart verwurzelt und auch verbreitet waren. Denn, in Japan ist die Schönheit das Resultat oder der Spiegel einer Geisteshaltung, die sich mit dem Wahren und Guten beschäftigt. Das Schöne und das Wahre gehören folglich zusammen. Und das Wahre wie auch das Gute wird von einer moralischen Komponente gespeist, die durch Religion (Zen-Buddhismus, Buddhismus, Taoismus und Konfuzianismus) und Tradition in der Gesellschaft breit verankert ist.
Faktisch bedeutet dies, dass nur der, der das Wahre und Gute erkennt und danach strebt, etwas hervorbringen kann, das in Japan als schön oder geschmackvoll wahrgenommen wird. Oft wird bei der Schönheit Japans von einer Schönheit gesprochen, die weniger an der Oberfläche als in ihrer scheinbar unergründlichen Tiefe zu liegen scheint. So langsam nähern wir und womöglich dem Warum. Nehmen wir als Beispiel die vom Zen-Buddhismus geprägten Weg-Künste, etwa die Kalligraphie. Das primäre Ziel ist nicht, eine möglichst ansprechende Kalligraphie zu erstellen, als sich in dem Prozess des Schreibens bewusst und unterbewusst mit dem Wahren und Guten auseinanderzusetzen. Wie bereits im Absatz zu den Künsten beschrieben, ist damit nichts Geringeres gemeint, als nach Erleuchtung zu streben. Gerade bei den Weg-Künsten liegt das Interesse weniger auf dem „schönen“ Produkt oder dem Selbstausdruck als auf dem Prozess des Erschaffens. Das Wahre, Gute und Schöne ist eine untrennbare Einheit – die Weg-Künste sind dem besonders verpflichtet.
Natürlich klingt das alles nun entsetzlich groß. Aber die „ästhetischen Konzepte Japans“ waren tatsächlich Konzepte unterschiedlicher moralisch-religiöser Geisteshaltungen, die in unterschiedlichen Ausdrucksformen, der Kunst, der Handwerkskunst, den Künsten und auch darüber hinaus ihren Ausdruck fanden.
Klingt kompliziert? Ja, vielleicht, aber wir nähern uns nun dem Kern, dessen, was auf den Seiten von Kunst aus Japan schon mehrfach als das „gewissen Etwas“ bezeichnet wurde. Und auch der westliche Rezipient scheint intuitiv zu spüren, dass man die japanische Ästhetik weniger verstehen, als vielmehr fühlen muss, um dem Schönen auf die Spur zu kommen. Es liegt an eben der spürbaren Tiefe der Konzepte, an der Geisteshaltung, an der moralischen Komponente, die sich im Objekt, Raum oder in der Handlung manifestiert.
Aber eben diese Durchdringung ob der Geisteshaltung macht eben nicht bei Kunst, Künsten oder Handwerkskunst halt. Die gesellschaftlich verankerte geistige Haltung (das Streben nach Wahrem und Gutem, das Streben nach Erleuchtung und einer besseren Welt), die in Form von Schönheit an die Oberfläche tritt, zog sich traditionell durch sämtliche Lebensbereiche, etwa das Anrichten von Speisen, die Wahl des Geschirrs, die Wahl der Kleidung, im Verpacken von Gegenständen, in der Wahl des richtigen Gedichts zur richtigen Gelegenheit. Das Streben nach dem Wahren und Guten ist ein tief verankertes Lebensprinzip und macht somit auch die Ästhetik in Japan zu einem Lebensprinzip. Ästhetik ist damit überall. Und ja, selbst der Samurai nimmt seine Rüstung ab, um die Christhemen zu bewundern. Es ist also nicht erstaunlich, dass es keinen „einzigen“ Begriff für das Prinzip der Ästhetik gab, als eine gewachsene Sammlung von Konzepten, die etwas ganz und gar Normales, Allgegenwärtiges und Natürliches beschreiben.
Die spürbare Tiefe der ästhetischen Konzepte und auch deren Verbreitung im Alltag gehen daher für mich engstens mit der Verknüpfung von Wahrheit und Schönheit einher.
Die ästhetischen Konzepte Japans
Es gibt in Japan eine immense Anzahl an ästhetischen Konzepten, die im westlichen Kontext nur vereinzelt bekannt sind, die aber in Japan seit Jahrhunderten zum absoluten Grundvokabular zählen. Zum Teil ist das noch heute der Fall. Hier nur einige wenige Beispiele: ate, en, fûga, wabi sabi, hosomi, karumi, kurai, mono no aware, mumon, okashi, reiyô, takedakeshi, yasashi, iki, yû. Die Liste könnte noch sehr lange fortgesetzt werden.
So unterschiedlich diese Konzepte auch sein mögen, so gibt es doch einige Aspekte oder Schlüsselideale, die sich wie ein feiner roter Faden durch die japanische Ästhetik ziehen. Donald Keene hatte sie wie folgt zusammengefasst:
Die Andeutung – die Unregelmäßigkeit – die Einfachheit – die Vergänglichkeit
Die Andeutung, dieses Prinzip ist eng verknüpft mit dem tief verankerten Respekt Japans vor der Natur, die, dem Shintoismus folgend, als beseelt und von Göttern bewohnt verehrt wurde. Die Natur hatte größten Einfluss auf die japanische Kunst, aber völlig anders als in Europa oder China, wo die Natur im Sinne der Mimesis häufig einfach detailgetreu nachgeahmt wurde. Auch die japanische Kunst hebt die Schönheit der Natur hervor. Doch die Künstler Japans gingen davon aus, dass die Natur der Natur niemals wirklich nachgeahmt oder dargestellt werden könne, weder durch literarische noch darstellerische Beschreibung. Wenn überhaupt, könne man sie nur andeuten, je subtiler, desto besser und desto stilvoller die Kunst. Dies wird auch im Haiku deutlich. Auch das japanische Kunsthandwerk imitiert die Mittel und Wege der Natur, nicht aber deren Abbild. Damit ist das vage bleibende, das verschwindende, das entschwindende, was wir auch in den Gedanken von Wabi Sabi finden, unter anderem auf das Prinzip der Andeutung zurückzuführen. Dieses ästhetische Empfinden ist einzigartig im weltweiten Vergleich. Wie völlig anders verhielt es sich etwa mit der westlichen Kunst bis zum 19. Jahrhundert, die im Dienste der Verherrlichung Gottes und von der vermeintlichen Dominanz des Menschen über die Natur prägend war.
Trotz aller Andeutung war die Natur eine bedeutende Quelle für die japanische Kunst. Auch Tanizaki schreibt: „Die Qualität, die wir Schönheit nennen muss immer aus der Realität des Lebens erwachsen.“ Eine angedeutete natürliche Schönheit! Wer Japan heute kennt, wird natürlich lachen, denn es ist erstaunlich, wie viel unglaublich „Künstliches“ es in Japan heute gibt.
Ein weiteres ästhetisches Prinzip, das die japanische Kunst aus der Natur ableitet, ist die Einfachheit. Es ist eine Einfachheit im Sinne von Sparsamkeit, oder einer nicht überladenen Anmutung der Dinge. Auch im Zen-Buddhismus ist die Einfachheit ein wesentlicher Wert. Ein Beispiel hierfür wäre die Teehütte im Einsiedlerstil, die im Zusammenspiel von den verbauten Materialien, von natürlichen Farben oder der Anordnung der Dinge im Raum den Eindruck von größter Einfachheit vermitteln. Diese Einfachheit kommt in vielen ästhetischen Kategorien zum Ausdruck, etwa Wabi Sabi oder iki. Sie galt als Grundbedingung für guten Geschmack. Ebenso verhält es sich mit dem Prinzip der Unregelmäßigkeit, die erneut als Ableitung von den Prinzipien der Natur betrachtet werden kann. Neben der Unregelmäßigkeit würde ich auch die Asymmetrie erwähnen.
Die Würdigung der Vergänglichkeit ist das unverkennbarste Ideal in der japanischen Ästhetik. Das Annehmen und gar Verehren der Vergänglichkeit des Lebens und der Dinge ist den Buddhistischen Lehren entlehnt. Dieses Ideal finden wir in der klassischen Verehrung der Kirschblüte oder in dem Ideal des Samurai, der auf dem Höhepunkt seiner Stärke und Schönheit stirbt. Die Bereitschaft des Samurais, einen würdigen Tod zu sterben, ist auch eine ästhetische Entscheidung. Damit gehen natürlich auch Traurigkeit und Schmerz einher, die jedoch über die Verehrung der Vergänglichkeit eine Umdeutung hin zum Schönen erfuhren.
Yoshida Kenkô: „Würde man nicht hinschwinden […], sondern ewig leben – wie könnte man da die zaubervolle Melancholie erfassen, die in allen Dingen webt? Gerade ihre Unbeständigkeit macht die Welt so schön“.
Ein Ideal, das sich ebenfalls durch etliche japanische Konzepte zieht, ist der Begriff der Eleganz, eine Qualität, die in Japan eine sehr große Rolle spielt. Grundsätzlich verweist die Eleganz in Japan auf das Spiel zwischen einem gewissen Maß an Opulenz und der ausgeprägten Anmut, die in der Zurückhaltung des Wesens und der Dinge liegt. Konkret war damit nicht nur das Gespür für Vornehmheit gemeint, als auch ein Gespür für die Schönheit der Bewegung, die Schönheit in der Erscheinung oder im Auftreten. Hierzu zählen auch vornehme Umgangsformen und eine grundsätzliche Kultiviertheit. Das Ideal der Eleganz ist auf die höfische Vorliebe (7.-12. Jahrhundert) für Anmut und Feinheit zurückzuführen.
Im Folgenden finden Sie eine kleine Auswahl an ästhetischen Konzepten, also Beispiele, die auf die hier beschriebenen Ideale aufbauen.
Wabi Sabi
Über Wabi Sabi habe ich auf den Seiten von Kunst aus Japan schon mehrfach geschrieben: Wabi Sabi Ästhetik / Wabi Sabi: mehr als ein Trend / Axel Vervoordt: Inspiration Wabi. Da die Auseinandersetzung mit diesem Thema durchaus komplex ist, muss ich einräumen, dass meine Artikel stets an der Oberfläche der Materie geblieben sind. Doch es gibt wunderbarte Literatur sowie online-Content zum Thema Wabi Sabi, auf die ich mit Freude verweise.
An dieser Stelle kann ich mich daher erneut nur darauf beschränken, Wabi Sabi auf einen möglichst einfachen Nenner zu bringen: Wabi Sabi beschreibt die Schönheit des Einfachen, des natürlich gealterten und der Vergänglichkeit. Wabi Sabi feiert die Authentizität der Natürlichkeit, der Bescheidenheit und Nüchternheit. Wer Wabi Sabi sucht, entdeckt die Würde und Eleganz der Unvollkommenheit.
Der Ausdruck geht auf zwei Begriffe zurück. Wabi kommt von vage oder verloren. Der ursprüngliche Wortstamm von Sabi bedeutet verschwinden, sich auflösen, rostig werden, erblassen, einsam sein. Das eigentlich bemerkenswerte ist, dass diese Begriffe mit ihren ursprünglich tristen und traurigen Anmutungen eine erstaunliche Umdeutung erfuhren, z.B. durch den Dramatiker, Schauspieler und Ästhetiker Motokiyo Zemai (1363-1443), der schon im 15. Jahrhundert in dieser Tristesse eine besondere Art der Schönheit ausmachte. Oder der Dichter Bashô. Er prägte das positive Bild des Begriffs, indem der unter anderem die Idee der absoluten Stille würdigte, die nur aus der Einsamkeit entstehen kann. Oder Daisetz Suzuki, ein großer Erklärer der Zen-Prinzipien. Er beschreibt Wabi als ästhetische Würdigung der Armut. Gemeint ist aber nicht die Ärmlichkeit, als vielmehr mit einer kleinen Hütte zufrieden zu sein, um Harmonie, Seelenruhe und Frieden zu finden.
Shibui
Der Begriff Shibui war bereits in der Muromachi-Zeit (ca. 1333-1568) bekannt. Das Adjektiv des Nomens beschrieb ursprünglich eine geschmackliche Empfindung: ein herbes, trockenes Empfinden auf der Zunge, als würde man in eine unreife Kaki-Frucht beißen. Aus der Sake-Verkostung kommend, könnte man dies mit dem Begriff Adstringenz beschreiben.
Im ästhetischen Sinn steht Shibui für Schlichtes, Dezentes und Bescheidenes. Dieses Ideal wurde durch den Stil des japanischen Kaiserhauses geprägt. Wo der Shôgun seine Macht durch Pracht und Glanz demonstrierte, erklärte die kaiserliche Familie ihren Machtanspruch durch ausdrückliche Zurückhaltung. Shibui wurde zu einem Ausdruck für jene Menschen, die das Subtile und die Zurückhaltung würdigen. Shibui bezog sich bald nicht mehr nur auf guten Geschmack, als auch auf gesellschaftliches Gebaren. Wir sprechen demnach nicht nur von der Verwendung dezenter Farben und einfacher Muster in der Kleidung, als auch von Sängern, die auf sehr zurückhaltende Weise vortragen, von Baseballspielern die sich nicht hervortun, als vielmehr in unspektakulärer Weise ihren Beitrag für das Spiel leisten. Das Adjektiv wird also nach wie vor verwendet. Seine eigentliche Popularität erlangte Shibui in der Edo-Zeit, als die wohlhabenden Städter begannen, einen gewissen Stolz auf ihren feinen und zurückhaltenden Geschmack zu entwickeln. Aber auch im Zen war Shibui ein Lebensideal.
Jôô Takeno (1502-1555) zitiert einst ein Gedicht von Fujiwara no Teika (1162-1241), um Shibui zu erklären:
So, wie ich weit schaue, sehe ich weder Kirschblüten noch verfärbte Blätter; Nur eine einfache Hütte an der Küste im Halbdunkel der herbstlichen Abenddämmerung.
Der Dichter legte den Fokus eben nicht auf die rosafarbenen, feierlichen Kirschen oder den hellen Ahorn. Er richtete seinen Blick auf die Hütte in der Abenddämmerung, in einer ohnehin schon dunklen Jahreszeit, wo alles Leuchtende in der Einfarbigkeit verschwindet. Das Gedicht lässt erahnen, dass nach japanischem Ermessen die wahre Eleganz nicht im Verschnörkelten, Komplizierten oder Gekünstelten liegt, als vielmehr in dessen glattem Gegenteil.
Yûgen
Ein ästhetisches Ideal, das stark auf dem Ideal der Andeutung basiert, ist Yûgen. Yûgen steht für„Geheimnis und Tiefe“. Die Silbe Yû bedeutet Düsterkeit oder Schattenhaftigkeit, Gen bedeutet Dunkelheit. Yûgen beschreibt einen künstlerischen Effekt, der für das Geheimnisvolle steht, als auch für all das, was sich nicht in Worte fassen lässt, das Unaussprechliche. Das ist ein subtiler und komplexer Ton mit sehr poetischer Tragweite. Arthur Waley (übersetzte den Prinzen Genji in‘s Englische) beschreibt Yûgen als das, was sich unter der Oberfläche befindet, es sei das Subtile im Gegensatz zum Offenkundigen, die Andeutung im Gegensatz zur eindeutigen Aussage oder zum klar ersichtlichen Bild.
Wie kann man sich das vorstellen? Waley führt als Beispiel etwa das behutsam Zurückhaltende im Sprechen und Auftreten eines Edelmanns auf. Fujiwara no Shunzei schreibt, „dass sich Yûgen an einem Herbstabend finden ließe, wo es weder eine Farbe am Himmel gibt noch einen Klang. Und obwohl wir keinen bestimmten Grund nennen können, warum das so ist, sind wir dennoch zu Tränen gerührt“. Es braucht als durchaus einen Zugang, um den wunderschönen Pathos wahrzunehmen, den Yûgen ausdrückt. Tatsächlich ist es nicht einfach, sich diese Dimension der japanischen Ästhetik vorzustellen, denn der Begriff deutet bereits an, dass das ästhetische Erkennen weniger durch Denken, als durch eine meditative Gewahrwerdung erreicht werden kann.
Yohaku no bi
Die Übersetzung von Yohaku no bi ist in allen Texten, die ich kenne, die gleiche: „Die Schönheit des übrig gebliebenen Weiß“ oder „Die Schönheit des letzten Weiß“. Es ist ein zentrales ästhetisches Prinzip in Japan. Vielleicht sind Ihnen auch schon Drucke aufgefallen, die gänzlich unbedruckte weiße Flächen aufwiesen, beinahe wie vergessene Stellen im Bild, oder Tuschemalereien, die sehr viel freie, weiße, oder nicht „genutzte“ Flächen aufweisen, die meist mit einer starken Asymmetrie des Bildes einhergehen. Diese freien Flächen sind kein Versehen, es sind Flächen, die Raum für Andeutung lassen, Andeutungen, die über das Werk hinaus auf einen in mir liegenden Gedanken verweist. Nicht alles wird gezeigt, so wie auch im Haiku nur das weinigste „gesagt“ wird und doch so unendlich viel zum Ausdruck kommt.
Mono no aware
Aware, ein Begriff der sehr häufig von Shikibu Murasaki in der Geschichte vom Prinzen Genji verwendet wurde, und das schon zu Beginn des 11. Jahrhunderts. Der Begriff stand seitdem für alles, was sich zwischen Eleganz und Pathos abspielt. Mono no aware ist noch heute ein sehr präsentes Lebensgefühl, das insbesondere in Filmen zum Ausdruck kommt. Gemeint ist die Kultivierung einer besonderen Empfänglichkeit für die vergängliche, flüchtige und subtile Schönheit, etwa die der Natur. Wie schon mehrfach beschrieben, wird die damit einhergehende schwermütige Melancholie als etwas Positives angenommen. Monon no aware feiert demnach den Pathos der Dinge, ein „So ist das Leben eben“. Es lebe das Ideal der Vergänglichkeit.
Iki
Iki und Wabi-Sabi haben viel gemein, auch wenn es auf den ersten Blick eher Unterschiede gibt. Doch beides sind komplexe Ideale, die neben dem Ästhetischen auch eine stark moralische Komponente beschreiben, wie Ueda Makoto in einem meiner liebsten Bücher, Versuch über die japanische Ästhetik, zitiert wird.
Der Begriff Iki fand zunächst in Samurai-Kreisen Anwendung, um einen Mann von Wert und Eleganz zu beschreiben, der dem Weg des Kriegers und der Ehre verfolgt. Die eigentliche Prägung und Ausweitung des Begriffs erfolge jedoch während der Edo-Zeit (1603-1868) unter den Städtern Edos.
Diese erlangten, obwohl sie im derzeit vorherrschenden Ständesystem zu den niedersten Klassen zählten, enormen Reichtum. Die Zeit des Friedens spielte ihnen in die Hände, da Handel und Handwerk endlich florierten. Und eben dieser „Städter“ wurden als bourgeoiser Typ beschrieben, schick, auf Ästhetik in sämtlichen Lebensbereichen bedacht, aber mit sehr sensiblen, weil eben auch moralischen Untertönen. Aus diesem Bild entwickelte sich eine neue Bedeutung von Iki. Wir sprechen von anspruchsvoller Urbanität, Raffinesse, Esprit, weltgewandte Klugheit und dennoch von einer Aura der Empfindsamkeit. Dies beinhaltet den Wunsch nach einem geschmackvollen Leben, aber ohne dabei am Geld zu hängt, sinnliche Freuden zu genießt, sich aber nicht durch Leidenschaften hinreißen zu lassen. Ein Mensch der weiß, was er will, ohne vom Leben übersatt zu sein. Iki bezeichnet einen gewissen Grad an persönlicher Reife, eine Person, die in ihrem Leben schon einiges gesehen hat, Schönes und Unglückliches. Ein Leben also, das sie sowohl anspruchsvoll, aber auch demütig und bescheiden werden ließ.
Iki ist damit elegant, ruhig und angesehen aber eben nicht arrogant, extravagant oder auffällig. Iki ist kultiviert und gebildet, ohne jedoch perfekt oder kompliziert zu sein. Somit ist der reiche Junge, der einfach alles hat, nicht zwingend Iki, aber ein gebildeter Mann mit guter Karriere, der „hervorsticht“, aber nicht, weil er sich selbst in den Vordergrund rückt, eben doch. Auch das ausgesuchte Interior von japanischen Häusern mit Tatami Matten ist Iki. Die moderne japanische avantgarde Architektur ist Iki. Ein hervorragendes Sushi ist Iki oder kann es zumindest sein. Und dieser „state of mind“ existiert noch heute. Das Gegenteil ist yabo oder busui, vulgär, rau und einfältig. Héctor Garcia beschreibt dies in A Geek in Japan sehr eindrücklich. Heute gilt Iki insbesondere als cool, wohl wissend, dass absolut nicht jeder und alles in der Lage ist, diesem Ideal gerecht zu werden.
Als abschließende Bemerkung zu den ästhetischen Konzepten Japans bleibt mir nur mehr zu sagen, dass diese keine starren Konzepte sind, die getrennt und strikt nebeneinander existieren. Im Gegenteil, meist liegen sie wie Schichten übereinander. Sie sind miteinander verbunden, bedingen sich gegenseitig und verstärken sich. Es geht als um ausgesprochen vielschichtige Konzepte, die eine Geisteshaltung, ein Gefühl oder schlicht die Innenwelt in den Vordergrund stellen. Es geht um Tiefe, Schlichtheit, Andeutung und Eleganz. Es geht um Imagination und Zurückhaltung, all jene Ausdrucksweisen für das Wahre und Gute, wie wir erfahren durften.
Ästhetik in Japan heute
Wabi Sabi, Iki, Mono no aware …wer denkt, im heutigen Japan all diese Konzepte und Ideale in Reinkultur noch immer erleben zu können, den muss ich leider enttäuschen. Auf den ersten Blick scheint dieses tiefe ästhetische Empfinden nicht mehr den Stellenwert in der Gesellschaft einzunehmen, wie dies einst der Fall war. Die Flut an Leuchtreklame, Plastikblumen, lärmenden Spielhöllen, infantilen Anime-Figuren in Lebensgröße oder lieblos domestizierter Natur scheint überwältigend zu sein. Jung und Alt laben sich an einem Stil der Verniedlichung aller Lebensbereiche, was allzu oft mit dem Ausruf „kawai“ guttiert wird. Natürlich wird auch kaum mehr im traditionellen Holzstiel gebaut. Aber! Es gibt nicht nur Cosplay und Hello-Kitty (und ich will auch gar nicht sagen, dass diese Phänomene nicht äußerst spannend sind und ihr Berechtigung haben). Aber inmitten all dieser lauten Töne gibt es noch so viel mehr. Und ich meine damit nicht nur die nun mehrfach zitierten Beispiele, von Zen-Garten bis Kimono. Ich spreche von alltäglicher Ästhetik, die sich häufig in liebevollen bis ausgeklügelten Details spiegelt, in geradlinger und schlichter Gestaltung, in eleganter und harmonischer Einrichtung, in dem Bestreben, die Schönheit der Jahreszeiten wann nimmer möglich in den Lebensalltag zu integrieren, in dem Bestreben, auch heute eine gewisse Form von Iki aufrecht zu erhalten.
麗 Kunst aus Japan ist – einfach – schön

Quellen: Versuch über die japanische Ästhetik, Donald Richie, MSB Matthes & Seitz Berlin Verlag 2020 / Ostasiatische Kunst, Herausgeber Gabriele Fahr-Becker, Tandem Verlag (Könemann) 2006 / Lob des Schattens, Jun’ichirô Tanizaki, Manesse 2011 / Lob der Meisterschaft, Jun’ichirô Tanizaki, Manesse 2012 / Wabi-Sabi. Woher? Wohin? Weiterführende Gedanken, Leonard Koren, Ernst Wasmuth Verlag 2015 / The beauty of everyday things, Yanagi Sôetsu, Penguin Classics 2018 / Geisha, Liza Dalby, Rowolt Taschenbuch Verlag 2000 / Die Struktur von „Iki“. Eine Einführung in die japanische Ästhetik und Phänomenologie, Shûzô Kuki, Hänsel-Hohenhausen – Verlag der Deutschen Hochschulschriften DHS 1999 / Handwerkskunst in Japan, Uwe Röttgen und Kathatrina Zettl, DK 2020 / Die Geschichte der Schönheit, Herausgeber Umberto Eco, dtv 2006
Sie interessieren sich für die Themen japanische Kunst, japanische Ästhetik und Interior Design? Sie lieben die Inspiration und lesen gerne einmal einen Artikel zu diesen Themen? Dann abonnieren Sie doch einfach den Kunst aus Japan newsletter.
Just be inspired.
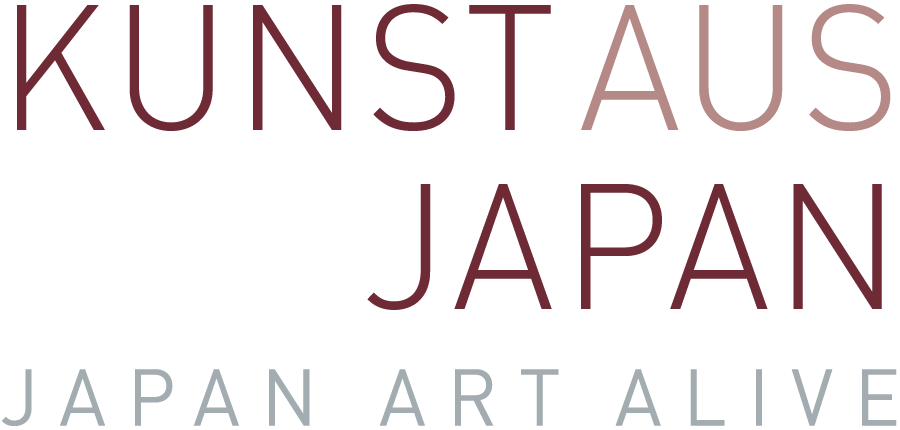





Schreibe einen Kommentar